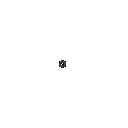Beiträge von tortitch
-
-
Hallo Tom,
kein Murakami-Fan?
-
Meine erste Begegnung mit C.C. war Return to Forever: Romantic Warrior. Al diMeola, Lenny White, Stanley Clarke mit dabei. Artistentum ganz hoch oben in der Kuppel.
-
1963 begeht Sylvia Plath mit 31 Jahren Selbstmord. Das ist, wenn man so möchte, der Schlussakt, den der zu guten Teilen autobiografische Roman nicht mehr erzählt. Dort endet es damit, dass Esther Greenwood, die Ich-Erzählerin, aus der psychiatrischen Anstalt entlassen wird. Vorher absolviert sie ein Voluntariat bei einem Modemagazin, versinkt in der Bedeutungslosigkeit, die das Leben für sie als Frau bereithält, versucht ihre Jungfräulichkeit loszuwerden, begeht einen Selbstmordversuch, wird Opfer einer Elektroschocktherapie, probiert in das Leben zurückzufinden. Mehr über den Inhalt kann man leicht in einem relativ umfangreichen Wikipedia-Artikel zu dem Roman erfahren.
Wieder komm ich hier mit ner ollen Kamelle. Dennoch würde ich das schmale Bändchen (262 Seiten) ins Regalabteil „lesenswert“ stellen. Nicht nur wegen der berührenden Geschichte, sondern auch wegen der Sprache, die sich selbst in der Übersetzung gut liest. Auch unbedeutende Begebenheiten beleuchtet die Autorin mit dem Licht ihrer feinen Metaphern und Vergleiche: „Der Motor begann ein Gebrumm, das sich auf knirschendem Kies davonschlich und schließlich in der Ferne verklang.“
Anderes Beispiel: „Jedesmal, wenn ich mich zu konzentrieren versuchte, glitten meine Gedanken wie Eisläufer in einen großen leeren Raum hinaus und drehten dort verloren ihre Pirouetten.“
Sagte ich ‚berührend‘? Sagte ich wohl. Ich sollte aber auch hinzufügen: bedrückend. Es ist die Erzählweise, die dem Leser berührend-bedrückend auf die Pelle rückt. Paradoxerweise liegt das aber gerade an der seltsamen Distanziertheit der Erzählweise. Es ist oft so, als stünde die Ich-Erzählerin ihrem eigenen Leben quasi entrückt gegenüber. Selbst der Horror der Elektroschocktherapie wird lakonisch-beobachtend dargeboten, ohne Erwähnung von Gefühlen oder Schmerzen: „Doktor Gordon befestigte zwei Metallplatten an beiden Seiten meines Kopfes. Mit einem Band, das sich mir in die Stirn einschnitt, schnallte er sie fest und gab mir einen Draht zu beißen.
Ich schloß die Augen.
Es trat eine kurze Stille ein, wie ein Atemanhalten.
Dann kam etwas über mich und packte und schüttelte mich, als ginge die Welt unter. Wii-ii-ii-ii-ii-ii schrillte es durch blau flackerndes Licht, und bei jedem Blitz durchfuhr mich ein gewaltiger Ruck, bis ich glaubte, mir würden die Knochen brechen und das Mark würde mir herausgequetscht wie aus einer zerfasernden Pflanze.
Ich fragte mich, was ich Schreckliches getan hatte.“
Wer einen spannenden Plot sucht, wird allerdings nicht fündig werden.
-
In der Musik-Branche wird seit Jahrzehnten eine Homogenisierung beklagt, die darauf abzielt Popmusik nach bestimmten „Rezepten“ zu kochen (nach wie viel Sekunden muss der Refrain das erste Mal auftauchen, wie viele verschieden Akkorde darf ein Song enthalten (in der Regel 4), welchen Dynamikumfang darf ein Lied haben?? etc.). Die großen Labels und Radiostationen schaffen so eine Monokultur, in der sie quasi als Monopolisten agieren können und sich durch Dauerberieselung ihr Publikum heranziehen. Gleichzeitig scheint es eine Gegenbewegung zu geben, eine enorme Ausdifferenzierung, bei der zahllose Subgenres entstehen (z.B. im Metalbereich) und die Künstler z.T. ihre eigenen Produzenten und Verleger werden (die technische Digitalisierung macht es möglich). Jeder Hörer findet seine eigene kleine Nische, was auf der anderen Seite bedeutet, dass ein „Kanon“ verloren geht.
Im Kino scheint es mir ähnlich auszusehen. Es gibt ein paar Blockbuster-Filme, die die Kinos auslasten und andere Filme verdrängen (was dann ggf. die Streaming-Dienste auf den Plan ruft). Auch die Blockbusterfilme sind stark an „Formeln“ orientiert (Zeittaktung, Figurenkonstellationen, spektakulärer „Schauwert“ statt narrative Kohärenz).
Analog also auch in der Literatur. Labels, Radiosender, Verlage etc. scheinen sich ausschließlich als profitorientierte Unternehmen zu verstehen (das sind sie natürlich ohnehin), aber kaum noch als Kulturvermittler. Die Funktion der finanziell unattraktiven Kulturvermittlung wird an den öffentlich-rechtlichen Bereich (den Staat) abgetreten (Subventionierung, Preisausschreibungen, Kulturprojekte), wobei diese Funktion auch hier im Rückgang begriffen ist (wenn man sich mal die Entwicklung bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern anschaut).
Diese Ökonomisierung der kulturellen Sphäre lässt sich - wenn man Leuten wie Colin Crouch („Postdemokratie“) glauben darf - auch im Bereich der Politik beobachten: Die Gestaltung des politischen Gemeinwesens werde zunehmend von den Profitinteressen einzelner Privatunternehmen beherrscht.
Was in der Musik möglich ist, funktioniert prinzipiell natürlich auch in der Literatur. Auch hier erlaubt die digitale Technik, dass der Autor gleichzeitig Lektor und Verleger ist. Unternehmen wie BoD nutzen diese Möglichkeit ja auch. Doch selbst wenn die Kleinverlage und Selbstverleger den großen Publikumsverlagen Marktanteile streitig machen könnten, bliebe ja noch die Frage, ob diese „Zersplitterung“ wünschenswert ist. Oben hatte ich schon auf den möglichen Verlust eines Kanons hingewiesen. Was bedeutet das für „die Kultur“? Ich würde behaupten, dass ein „gesunder“ Kulturbetrieb auch immer eines Kanons bedarf, der es den Kulturteilnehmern erlaubt, über ihn zu sprechen, einen Diskurs zu installieren, in dem man sich über moralische und natürlich künstlerisch-ästhetische Normen austauscht. Ohne eine gewisse Form von Normativität gibt es m.E. keine Kultur (sonst zerläuft alles im Beliebigen). Vielleicht ist eine Hierarchisierung gemäß „Hoch- und Unterhaltungskultur“ dann unausweichlich.
-
Das Beste wird es sein, für seinen eigenen Roman ein Genre zu erfinden (zumal wenn man Schwierigkeiten mit der Zuordnung hat). Ob es das Genre wirklich gibt (was an sich schon eine kuriose Existenzaussage ist), weiß ja bei der Masse und dem Wirrwarr ohnehin niemand. Wenn man dann mit seinem Werk und Genre bei einer Agentur oder einem Verlag vorstellig wird, geraten die unweigerlich in Nervosität. "Verdammt, bedienen wir diese Genre schon?" "Ne, glaub nicht." "Herrje, dann müssen wir schleunigst etwas unternehmen!" Und zack hat man nicht nur einen Vertrag, sondern auch ein exklusives Genre. Hammer!
-
Zuletzt habe ich gelesen: Meyerhoff, T. Mann, Seethaler, Lucy Fricke, Bernhard, Sylvia Plath, Kehlmann.
Wie sieht es da mit den Genres aus? Weiß nich.
Dann behaupte ich mal ins Blaue:
Die Leute in den Agenturen und Verlagen, wissen nicht, was ein Hit werden kann (und was nicht). Sie machen es wie die Leute früher beim Wetterbericht: Sie gucken, wie es gestern gewesen ist und was gestern gut gelaufen ist und extrapolieren dann "Kriterien" für das, was gedruckt werden soll. Da sind Genres ein gute Hilfe. Wenn Regionalkrimis gut laufen, dann gibt es halt in den Buchhandlungen viele Regionalkrimis. Und das Angebot bestimmt ja auch die Nachfrage.
Nach meinen - äußerst bescheidenen - Erfahrungen mit Agenturen und Verlagen wird da schon sehr auf Genre und Zielgruppe geguckt. Mir kam das immer sehr ängstlich und hilflos vor.
-
Hallo Peter,
das mit dem Verzetteln kann ich sehr gut verstehen. Das Gefühl habe ich auch oft.
Ich hoffe sehr, dass du irgendwann wieder auftauchst.
Liebe Grüße
Tortitch
-
Thomas Bernhard: Der Untergeher
4 von 5 Sternen.
Ein Mann (der Ich-Erzähler), der von einer Beerdigung kommt, betritt ein Wirtshaus und lässt sich von der Wirtin ein Zimmer zeigen. Anschließend geht er zu dem Haus, in dem der Verstorbene zuletzt gewohnt gewohnt hat.
In der Taschenbuch-Ausgabe zieht sich das über 242 Seiten. Keine 10 % davon gehen auf das Konto der beschriebenen äußeren Handlung. Der Rest wird von einem inneren Monolog ausgefüllt, in dem es um Glenn Gould, Wertheimer und den Ich-Erzähler geht. Wertheimer ist ein Freund des Ich-Erzählers und er ist auch der, der bei der Beerdigung bestattet wurde, nachdem er Selbstmord begangen hatte. Die drei lernen sich 1953 bei einem Klavierseminar von Horowitz kennen. Wertheimer und der Ich-Erzähler hören Glenn Gould die Goldberg-Variationen von Bach spielen und sind – als Klavierspieler und nicht nur als solche – vernichtet. Ihnen ist sofort klar, dass sie im Vergleich mit dem Genie Gould ohne Bedeutung sind. Während der Ich-Erzähler Goulds „Klavierradikalismus“ zwar bewundert, sich aber noch halbwegs distanzieren kann, geht der „Untergeher“ (Wertheimer) an dem Vergleich mit dem Genie zugrunde. Er entkommt seiner eigenen „Lebensfalle“ nicht mehr und wählt irgendwannden Selbstmord.
Das Genie, sein Kunstradikalismus und die Frage, wie man dem begegnet, ist eines der Themen, das immer wieder aufgegriffen und in gedanklichen Schleifen variiert wird. Formal mag man hier also die Variation (und ihre Redundanz) als strukturbildend erkennen. Auf jeden Fall gibt es den typischen Bernhard-Sound und das Fehlen von Kapiteln (und weitgehend auch Absätzen).
Nichts für graupelverschauerte Novemberabende, wenn’s einem ohnehin schon misanthropisch im Brustkasten nistet.
Der Roman ist von 1983 und Glenn Gould war in Wirklichkeit kein Schüler bei Horowitz.
-
Unbedingt.
Als ich vor inzwischen einigen Jahren bei Lea Korte einen Romankurs belegt hatte, haben wir immer als Hausausgabe zur jeweiligen Lektion eine Szene schreiben müssen - natürlich eine sieben Mal korrigierte, so wie wir es bei Lea gelernt hatten. (Nein, das ist kein Zeichen von: Ich lasse mir alles einreden, aber tatsächlich stimmt das mit den sieben Schleifen etwa, die eine Szene bei mir braucht.) Als ich meine Hausaufgabe einmal von unterwegs ablieferte, wo ich keinen Drucker zur Verfügung hatte und also die letzten beiden Schleifen ohne Papierausdruck machen musste, bekam ich meine korrigierte Szene von Lea mit der Bemerkung zurück: "Ich habe das Gefühl, dass Du diesmal nicht so gründlich überarbeitet hast wie sonst."
Das hat mich jedenfalls noch einmal darin bestärkt, dass ich immer auf dem Papier korrigieren muss. Ich habe das aber sowieso auch vorher immer schon gemacht.
Das mit der Genauigkeit oder Intensität ist ein Punkt. Manchmal fühlt es sich tatsächlich mit dem Füller in der Hand besser an, "näher dran".
-
Jepp. Hat den Vorteil, ich kann den Ausdruck überall mir hinnehmen. Ins Bett, aufs Klo, in die Badewanne …
Mit Laptop etc. fühle ich mich sogar noch variabler oder mobiler als mit Papier. Allerdings habe ich manchmal die Neigung den ersten Entwurf in Hefte zu schreiben.
-
Bei Kurzgeschichten: Ja. Oft sogar mehrere (gerade eben habe ich eine 14 Seiten lange Kurzgeschichte zum achten Mal seit Schreibbeginn, der vor zehn Tagen war, ausgedruckt). Bei Romanen: Jein. Gelegentlich. Teilweise. Eher selten und nur fragmentarisch. Meistens lese ich eine PDF-Version oder etwas anderes, schön Formatiertes auf dem zweiten Bildschirm oder auf dem iPad, während ich die Korrekturen dann gleich in den Originaltext einbaue. Oder später, wenn ich das Gefühl habe, die Korrektur erledigt sich noch im folgenden Text von selbst. Ich neige zuweilen zu Verschlimmbesserungen.

Ja, meine Lieblingsalternative zu Papiervariante wäre auch Laptop plus Ipad. Dazu Srivener.
-
Zuletzt habe ich den Tipp beherzigt (ich glaube von Eschbach), zur Überarbeitung den Text auszudrucken. Lief auch so weit ganz gut. Aber jetzt muss ich den ganzen Schmodder wieder reintippen. Nun bin ich mit dem Verfahren doch nicht besonders glücklich.
Baut ihr bei der Überarbeitung auch immer eine "Papier-Stufe" mit ein?
-
Da ich die beiden ersten (Teil-)Romane des „Joseph“ im Zusammenhang gelesen habe, möchte ich kurz „Der junge Joseph“ ergänzen. Auch dieser Teil erscheint noch in Deutschland (1934). Sich eindeutig von seinem Heimatland (und damit auch vom Nazi-Regime) zu distanzieren, fällt dem Taktierer Mann schwer. In einem Brief an Einstein schreibt er 1933, der Bruch mit Deutschland passe nicht zu ihm. Seine Natur sei mehr von goethisch-repräsentativen Überlieferungselementen bestimmt.
Die äußere Handlung des Romans gibt nicht viel her:
Das Mutter- bzw. Vatersöhnchen Joseph macht sich durch Denunziationen weiter unbeliebt und hinterbringt bei jeder Gelegenheit dem Vater die Vergehen seiner Brüder. Als wäre das noch nicht genug, provoziert er die Neider durch das Erzählen von Träumen mit etwa diesem Tenor: „Ätschi, eure Garben haben sich vor meiner Garbe verneigt.“ Schließlich überredet er seinen Vater, ihm ein Prunkgewand, das Rahel, seiner Mutter, gehört hat, zu übergeben. Dieses Gewand symbolisiert vor allem auch das Erstgeburtsrecht.
Zürnend und enttäuscht ziehen die Brüder mit den Schafherden (Jaakob und seine Kinder leben im Wesentlichen von Schafzucht) zu fernen Weidegründen. Jaakob besinnt sich, dass er doch auch seine Nicht-Lieblingssöhne gern um sich hätte, und schickt Joseph zu ihnen, damit er sie zur Rückkehr bewege. Joseph jedoch fällt nichts Besseres ein, als ausgerechnet in dem brisanten Prunkgewand vor den Brüdern zu erscheinen. Sie haben endgültig die Nasen voll, schlagen Joseph zusammen und werfen ihn in einen ausgetrockneten Brunnen. Dort verbringt er gefesselt drei Tage, bis seine Brüder es für ratsam halten, ihn an zufällig vorbeiziehende ismaelitische Kaufleute zu verschachern.
Weder ist Joseph ein Adrenalin-Junkie noch liegt ihm an der Provokation. Sein törichtes Verhalten resultiert einfach daraus, dass er nicht begreifen kann, dass jemand ihn (den Schönling und Auserwählten) weniger lieben könnte als sich selbst.
Bereits in der Inhaltsangabe erkennt man das Regiment mythischer, immer wieder sich aktualisierender Muster: Konflikt um das Erstgeburtsrecht, „Auferstehung“ nach drei Tagen (eine Auferstehungsgeschichte erzählt auch Joseph seinem kleinen Bruder Benjamin) . Die Entindividualisierung und Reproduktion mythischer Blaupausen wird besonders an der Figur des Eliezer durchdekliniert. Eliezer ist ein Knecht Jaakobs, der sich um die Erziehung und Bildung Josephs verdient macht, indem er ihn in den mythischen Überlieferungen unterweist. Eliezer nun ist nicht nur konzeptionell eine Wiederkehr, sondern namentlich in dem Sinn, dass auch der Stammvater Abraham einen Knecht dieses Namens hatte. Und in den Erzählungen des aktuellen Eliezer wird deutlich, dass er zwischen sich und dem Vor-vor-vor-Gänger nicht all zu genau unterscheidet. Wenn er von Abrams (Abrahams) Eliezer erzählt, spricht er gern so, als sei er es selbst gewesen.
Etwas anders verhält es sich mit Joseph. Auch er sieht sich in das mythische Narrativ eingebunden und er ist auch bereit, seine Rolle zu spielen. Doch er spielt sie eben nur. Er ist der Spieler und Artist, also der bei Mann selten fehlende, von intellektueller Durchdringung angekränkelte Künstlertyp. Allerdings ein von Selbstliebe verblendeter Typ, der in den ausstehenden zwei Romanteilen noch einige Lektionen lernen muss, bis er die Synthese von Mythos und Wissenschaft (Psychologie) und den sozial verantwortlichen Künstler repräsentieren kann.
-
Ja, Buddenbrooks auf jeden Fall. Und wem das zu lang vorkommt, nimmt was von den Novellen/Erzählungen:
Der kleine Herr Friedemann, Tristan oder Wie Jappe und Do Escobar sich prügelten. Oder so.
-
-
-
Vorweg:
- Thomas Mann scheint kein Autor zu sein, den man gern liest oder nicht gern liest. Vielmehr scheint der Fall des Nicht-gern-Lesens oft mit einer leicht erhöhten Heftigkeit daherzukommen, der es gefällt, seinen Wert zu relativieren. Diese Haltung habe ich nie ganz verstanden.
- Mitunter wird sein Stil für schwülstig gehalten. Wenn man unter „schwülstig“ etwa „wolkig, sahnehaubig, klischeehaft“ versteht, ist das Urteil falsch. Mann scheint mir eher immer um größte Präzision bemüht, mit einer Differenzierungslust, die gern in ein fontanesches Sowohl-als-Auch gerät. Das sei zugestanden. Wenn unter „schwülstig“ allerdings verstanden wir, dass Mann das äußerlich Erzählbare gern in das weitläufige Netz seiner Begriffsdichotomien hängt, wenn man meint, dass er stets mit einem Fuß im Himmel der Ideen und des Geistigen baumelt, dass er - wie Carnap urteilen würde - ein Metaphysiker ist, dann ja, dann ist er schwülstig, was allerdings weniger ein Stilurteil wäre als die Beschreibung einer Weltanschauung.
Als ich überlegte, in welche Rubrik ich meine Darstellung packen sollte, fand ich, dass ein Roman, der bald hundert Jahre alt ist, nicht gut in die „Vorstellungen“ passt. Bei der „Romananalyse“ passt es aber noch weniger. Daher also doch bei den Buchempfehlungen.
Ähnlich wie beim „Zauberberg“ war der Josephsroman längst nicht mit dem tatsächlichen Umfang geplant, wucherte dann aber im Laufe der Jahre zu einer Tetralogie heran. Von 1926 bis 1942 tüftelte Thomas Mann an dem Roman bzw. an den Romanen. Ein Grund für die Ausuferung war Manns Überzeugung, dass er Josephs Geschichte, so wie er sie erzählen wollte, nicht ohne einen verdammt gründlichen Blick auf die Vorgeschichte ins Werk setzen könne. So kommt es, dass der erste Roman noch gar nicht oder nur weniger von Joseph handelt und mehr von seinem Vater Jaakob.
Dieser erste Teil (Die Geschichten Jaakobs) erscheint 1933 (durchaus noch in Deutschland, auch wenn TM im Februar das Land verlassen hat).
Jaakob, nicht ganz lauter, betrügt seinen Bruder Esau um den Vatersegen und somit um das Erstgeburtsrecht. Aus Angst vor Rache flieht Jaakob zu seinem Onkel Laban, in dessen Dienst er tritt. Er verliebt sich spornstreichs in Labans Tochter Rahel, muss aber, um sie als Ehefrau zu bekommen, sieben Jahre für Laban arbeiten. Dieser (gern auch mal als „Teufel“ bezeichnet) ist ebenfalls nicht frei von Tücke und schiebt verschleiert seine andere Tochter, Lea, als Braut unter. Was soll Jaakob tun? Er dient weitere sieben Jahre, um auch Rahel heiraten zu dürfen. Während der sieben und sieben Jahre wird Jaakob ziemlich wohlhabend. Mit seiner Rahel aber hat er weiterhin Pech. Sie bekommt nämlich - anders als Lea - keine Kinder. Ersatzweise gebären die Mägde Bilha und Silpa für sie Söhne. Dann jedoch, als Jaakob schon nicht mehr ganz daran glaubt, wird Rahel noch schwanger und bringt Joseph zur Welt. Es gibt dann sogar noch einen Nachzügler, Benjamin, bei dessen Geburt Rahel stirbt.
Wohlhabend und mit stattlicher Nachkommenschaft kehrt Jaakob nach Kanaan zurück und versöhnt sich mit Esau.
Dieser Handlung vorangestellt ist allerdings ein „Vorspiel: Höllenfahrt“. Jaakob trifft am Brunnen seinen hier bereits jünglingshaften Lieblingssohn Joseph. Im Gespräch kommt heraus, dass es zwischen Joseph und seinen Brüdern erhebliche Spannungen gibt.
Überhaupt der Brunnen. Der ist Hauptmotiv oder - symbol nicht nur dieses ersten Romans (der zweite Teil - „Der junge Joseph“ - endet z.B. damit, dass die Brüder Joseph in einen Brunnen werfen). Im Vorspiel steht der Brunnen für Zeittiefe, ontologische Tiefe und psychologische Seelentiefe. Jaakobs Betrug an Esau ist - eschatologisch, wenn man so will - legitimiert, weil Jaakob im Vergleich zu seinem eher animalischen Bruder über die nötige Seelentiefe verfügt. Er ist der zartere, geistigere und weiß das auch.
Gleichzeitig deutet der Brunnen in die bodenlose Vergangenheit, in die Menschheitsgeschichte, in der sich kein Anfang ausmachen lässt. Für jedes historische Ereignis muss es eine Ursache geben, so dass man am kausalen Gängelband umstandslos in einen unendlichen Regress gerät. Soweit die „wissenschaftliche“ Perspektive. Anders dagegen der Mythos. Er setzt zwar auch keinen Anfangspunkt, vielmehr nimmt er es mit der Chronologie nicht so genau, sondern konstituiert ein umfassendes „Zugleich“. Handlungen und Handelnde sind nicht so sehr individuell, sie folgen eher (mythischen) Mustern, von denen her sie ihre Bedeutungen erhalten. So ist Jaakob nicht nur Jaakob, sondern das Bruder-Verhältnis zu Esau spiegelt auch das Verhältnis von Kain und Abel wider, wie auch der sich andeutende Zwist zwischen Joseph und seinen Brüdern diesem Muster entspricht. Indem die Figuren sich als Repräsentanten solcher Traditionen sehen, erwächst für sie daraus Sinn und Verpflichtung (bei Joseph wird diese mythische Verankerung später allerdings brüchig).
Wie schon bei seinen Vorläufern, die an einem „neuen Mythos“ basteln (Frühromantiker, Wagner, Nietzsche), ergibt sich natürlich auch für Thomas Mann das Problem, dass man nicht in naiver Weise an den Mythos glauben kann. Was er anstrebt, ist eine Synthese aus Wissenschaft (Psychologie) und Mythos, also eine aus jüdisch-christlichem Ursprung erwachsene Kultur, die trotz aller intellektueller „Entzauberung“ (Weber) Sinn- und Sittlichkeitsorientierung stiften kann.
Was ist der Brunnen noch? Natürlich auch Zugang zur Unterwelt. Für die Motiv-Struktur des Romans bzw. der Romane ist der Komplex Unterwelt und Unterwelt-Gang prägend. Da verliert man schnell die Übersicht, weil Mann hier nicht nur den Persephone-Mythos heranzieht, sondern auch ägyptische und sumerisch-babylonische Mythen.
Überhaupt hat Mann sich während der Jahre der Arbeit offenbar ein stupendes ägyptologisches etc. Wissen angeeignet und er selbst merkt in einem Brief die Gefahr an, dass im Roman das Akademisch-Wissenschaftliche zu Ungunsten des Erzählerischen ein Übergewicht bekommen könne. Tatsächlich ist die Ausbreitung des Bildungswissens, die Mann betreibt, mitunter ermüdend.
Nicht so ansprechend finde ich auch den archaisierenden Mythenstil, den TM praktiziert. Das bezieht sich auf eine z.T. altertümelnde Wortwahl sowie auf Inversionen im Satzbau, die eine Anmutung von „Damals“ heraufbeschwören sollen (vielleicht). Freilich wird dieser Stil auch immer wieder ironisch gebrochen.
Ist es also nun eine Buchempfehlung? Wenn man an die Josephsromane heran will, sollte man eine gewisse Investitionsbereitschaft mitbringen. Und das bezieht sich nicht nur auf Zeit und Mühe, sondern auch auf das Pekuniäre. Ich würde die Große Kommentierte Frankfurter Ausgabe inklusive Kommentarband empfehlen. Dann wird das allerdings ein recht teurer „Spaß“.
-
Tschuldigung. Wollt ich eigentlich unterdrückt haben.
-
Metaphern, Verben, Satzlängen, um mal auf der unteren Ebene zu bleiben.
Dann Timing (also wie viele Sätze verwendet der Autor auf ein Thema oder einen Gedanken).
Mischung von Textsorten (Beschreibung, Bericht, Reflexion, Dialog).
Einfacher ist es allerdings bei nicht so guten Texten zu gucken, was da im Argen liegt, um sich das dann möglichst klar zu machen.